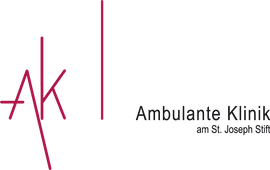Aktuelle Praxisinformationen
-
Psychosomatische Beschwerden: Von wegen alles Einbildung
Von Karin König, tagesschau.de
Beim Begriff "psychosomatisch" schwingt für viele Patienten der Vorwurf mit, ihre Symptome seien eingebildet oder gar vorgetäuscht. Dabei sind Beschwerden ohne klare körperliche Ursache weit verbreitet - und gut behandelbar.
Rebecca ist zwölf Jahre alt, als sie plötzlich Verdauungsprobleme bekommt. Obwohl sie nie Probleme damit hatte, hat sie auf einmal jeden Tag mit Bauchschmerzen und Durchfällen zu kämpfen. "Das kam so abrupt, dass ich tatsächlich anderthalb Jahre am Stück krankgeschrieben war und auch nicht mehr zur Schule gehen konnte", erzählt die heute 21-Jährige.
Ihr erster Weg führte Rebecca damals zum Hausarzt. Der fand keine Erklärung für ihre Beschwerden und verwies sie für eine Darmspiegelung an den Gastroenterologen. Auch hier: Kein auffälliger Befund, also wurde sie wieder zurück zum Hausarzt geschickt. Der stellte ihr die Diagnose Reizdarm-Syndrom, eine funktionelle Störung zwischen vegetativem Nervensystem und der Darmmuskulatur.
Jede Art von Symptom ist möglich
Damit hatte Rebecca vergleichsweise Glück, denn oft müssen Patienten mit funktionellen Beschwerden einen langen Weg von Facharzt zu Facharzt auf sich nehmen, bis sie eine passende Diagnose erhalten. "Wir haben immer noch das Problem, dass häufig sechs bis sieben Jahre vergehen, bevor Patienten überhaupt in spezialisierte Behandlung kommen", sagt Florian Junne, Klinikdirektor der Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Magdeburg.
Psychosomatische Medizin
Die Psychosomatische Medizin beschäftigt sich mit einer Bandbreite an Erkrankungen. Dazu zählen psychische Krankheiten wie Magersucht oder Depressionen, die psychologische Begleitung von schwer körperlich Erkrankten im Bereich der Psychoonkologie und die Behandlung von funktionellen Körperbeschwerden. Gemeint sind damit Beschwerden, die nicht durch strukturelle Veränderungen am Körper erklärbar sind, den Patienten aber trotzdem in ihrer Funktionalität einschränken.
Dabei kann fast jedes Symptom von Schmerzen über Schwindel bis zu Übelkeit funktionell begründet sein, so Junne. "Sie haben dann vielleicht jemand, der sagt, ich habe ein Kribbeln überall im Körper, ich habe Bauchschmerzen, ich habe Gliederschmerzen."
Rückenschmerzen aus dem Nichts
Bei Grete waren es Rückenschmerzen. "Also aus dem Nichts", beschreibt die Hamburgerin ihre Erfahrung. "Ich bin immer sportlich aktiv gewesen. Also hat mich das natürlich sehr überrascht, und ich war ein bisschen schockiert." Vor allem, als es nicht besser wurde. Um die Schmerzen abzuklären, besucht sie mehrere Orthopäden.
"Der erste Arzt meinte, es wäre vermutlich ein Bandscheibenvorfall. Der zweite Arzt sagte, es wäre eventuell eine Bandscheibenvorwölbung, also ein bisschen weniger schlimm." Grete bekommt Physiotherapie verschrieben, die sie monatelang macht, nimmt Schmerzmittel. Nichts bringt eine langfristige Verbesserung. Die 45-Jährige, die das Tanzen geliebt hat, muss es aufgrund der Schmerzen aufgeben. "Die Welt wurde immer kleiner. Man ging dann nur zum Arzt und zur Arbeit und das war's."
Vorwurf der Simulation
Sowohl Grete als auch Rebecca haben Symptome, die ihren Alltag teilweise stark beeinträchtigen. In Röntgenbildern oder Blutuntersuchungen zeigen sich aber keine Auffälligkeiten, die ihre Beschwerden ausreichend erklären, und konventionelle Therapien schlagen nicht an. "Es gibt Leute, die dann denken, diese Beschwerden sind eingebildet", sagt Constanze Hausteiner-Wiehle, Oberärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der BG Unfallklinik in Murnau.
"Patienten haben mit verschiedenen Vorurteilen zu kämpfen, etwa sie seien 'Simulanten', oder sie bekommen gesagt, 'Reiß´ dich zusammen' - und das ist richtig fatal", so Hausteiner-Wiehle. Sie ist eine der Autorinnen der S3-Leitlinie zur Behandlung funktioneller Körperbeschwerden. Dieser Leitlinie zufolge sind funktionelle Symptome der Grund für 20 bis 50 Prozent der Besuche bei Hausarztpraxen.
Komplexes Wechselspiel biopsychosozialer Faktoren
Der Vorwurf der Einbildung stigmatisiere die Patienten, sagt die Oberärztin. Und er hat außerdem mit der Realität nichts zu tun. "Das System unseres Organismus' funktioniert nicht so simpel, dass A immer zu B führt, sondern A, B und C hängen mit D, E und F in Wechselwirkung zusammen." Demnach entstehen funktionelle Beschwerden durch ein komplexes Wechselspiel aus körperlichen, psychischen und sozialen Faktoren.
Jeder Mensch erlebe in seinem Alltag funktionelle Symptome. Dazu zähle zum Beispiel die Übelkeit vor einem großen Vortrag, die geröteten Wangen in einer unangenehmen Situation oder der sogenannte Erwartungshochdruck. "Da sitzt man beim Doktor und hat an sich einen niedrigen Blutdruck. Und dann hat man vielleicht irgendwie mal unangenehme Erfahrungen beim Arzt gemacht und der Blutdruck geht hoch in dem Moment, wo der reinkommt", erklärt Hausteiner-Wiehle.
In diesem Fall könne man die Reaktion des Körpers sogar mit medizinischen Geräten messen, obwohl der Auslöser nicht etwa eine Erkrankung des Herzkreislaufsystems ist. "Daran kann man ablesen, was das Funktionelle ist in unserem Organismus: zum Beispiel Aufmerksamkeitslenkung, Anspannung, körperbezogene Erfahrungen oder Erwartungen."
Ein Software-Fehler im Gehirn
Bei chronischen Beschwerden gibt es oft tatsächlich einen ersten eindeutig körperlichen Auslöser wie eine Verletzung oder eine Infektion. "Und unter dem Einfluss verschiedener begünstigender Umstände kann sich daraus eine anhaltende oder wiederkehrende Dysregulation im Körper entwickeln", erklärt Stoyan Popkirov, Facharzt für Neurologie an der Uniklinik in Essen. Zu diesen begünstigenden Umständen zählen demnach beispielsweise eine hohe Stressbelastung oder eine psychische Erkrankung.
Diese Faktoren können dazu führen, dass die Reizverarbeitung im Gehirn gestört wird. So werden auch dann noch Schmerzen wahrgenommen, wenn der körperliche Auslöser nicht mehr gegeben ist. "Vereinfacht kann man funktionelle Störungen in der Abgrenzung zu strukturbedingten Erkrankungen als Software-Probleme im Gegensatz zum Hardware-Schaden bezeichnen", sagt Popkirov. In dieser Analogie ist der chronische Schmerz oder das chronische Symptom eine Fehlwahrnehmung in der Software des Gehirns.
Die kann man teilweise sogar bildlich darstellen. So haben britische Wissenschaftler bereits 2010 mithilfe funktioneller MRTs Unterschiede in der Hirnaktivität von Patienten mit funktionellen neurologischen Symptomen und einer gesunden Kontrollgruppe nachgewiesen.
Ein weibliches Phänomen?
Auch wenn medizinische Klischees wie das der "Weiblichen Hysterie" heutzutage in keinem Lehrbuch mehr zu finden sind, leiden Frauen häufiger als Männer unter funktionellen Beschwerden. Gleichzeitig haben sie es schwerer, im Gesundheitssystem mit diesen Beschwerden ernst genommen zu werden.
"Es gibt schon dieses Abziehbild vom männlichen Doktor mit einem heroischen, rein technischen Medizinverständnis, der einem Phänomen gegenübersteht, das er nicht kapiert, weil er es nicht messen kann", bestätigt Hausteiner-Wiehle. "Und der dann den schwarzen Peter rüberschiebt und so etwas sagt wie 'weibliche Überempfindsamkeit.'"
Das kann negative Auswirkungen auf die Behandlung haben, wenn es dazu führt, dass Ärzte die Patientinnen nicht ernst nehmen. In einer Studie aus Schweden zeigten Wissenschaftler zum Beispiel, dass männliche Ärzte doppelt so häufig Beruhigungsmittel für die Behandlung weiblicher Patienten mit Reizdarmsyndrom empfahlen wie Ärztinnen.
Wieso mehr Frauen betroffen sind, ist nicht abschließend geklärt. Ein Grund könne aber sein, dass Frauen durchschnittlich anders mit Beschwerden umgingen. "Frauen reden eher über das, was in ihnen los ist und gehen eher zum Arzt", so die Oberärztin. "Die andere Seite ist nämlich: Wir haben ein Riesenproblem in der Medizin mit Männern, die nicht zum Arzt gehen, die ihre Beschwerden verharmlosen und ihre Sorgen wegtrinken. Zudem ist es auch so, dass Frauen, zumindest in Friedenszeiten, tendenziell mehr belastende Lebenserfahrungen mitbringen als Männer." Und diese wiederum erhöhten das Risiko für funktionelle Beschwerden.
Positive Körpererfahrungen ermöglichen
Für funktionelle Körperbeschwerden gibt es nicht ein Medikament, das hilft. Stattdessen muss die Therapie multimodal ausgerichtet sein. Bei chronischen Schmerzen kann das beispielsweise bedeuten, dass mit Physiotherapie und Schmerzmitteln gearbeitet, gleichzeitig aber auch nach möglichen Stressfaktoren im Umfeld gesucht wird.
"Wir versuchen, die Erkrankung im biopsychosozialen Kontext zu verstehen und dann ein Krankheitsmodell mit den Patienten gemeinsam zu erarbeiten", erklärt Junne aus Magdeburg. Es sei wichtig, neue positive Körpererfahrungen zu ermutigen, sagt auch Hausteiner-Wiehle. Die Patienten sollen erleben, dass ihr Körper funktioniert und sie sich wieder auf ihn verlassen können. "Da kann man natürlich in einer Psychotherapie drüber reden, aber hauptsächlich muss man es wieder erleben. Es ist wichtig, positiv, aktiv und erlebnisbezogen zu therapieren, zum Beispiel durch eine Kombination von Physiotherapie und Psychotherapie."
Was tun, wenn man selbst betroffen ist?
Grundsätzlich müssten Beschwerden jeder Art zuerst körperlich abgeklärt werden, sagt Neuologe Popkirov. Das beginnt beim Hausarzt, der Patienten dann bei Bedarf an den entsprechenden Facharzt weiterleiten kann. Werden keine körperlichen Ursachen für die Beschwerden gefunden, sei es trotzdem empfehlenswert, bei den Fachärzten in Behandlung zu bleiben, dem die Symptome zugeordnet sind.
"Mit Herzrasen also beim Kardiologen, mit Reizdarm beim Gastroenterologen, mit Schwindel beim Neurologen", so Popkirov. "Denn das sind die Leute, die solche Patienten häufig sehen, die eine Diagnose sicherstellen können, die eine alternative Erkrankung nicht übersehen würden und dann Ratschläge geben können, wie es weitergeht." Das kann bedeuten, eine Physiotherapie oder Psychotherapie zu beginnen oder auch eine psychosomatische Reha zu machen. Außerdem können sich Patienten an psychosomatische Institutsambulanzen wenden.
Hoffnung auf Besserung
Nachdem Grete beim dritten Arzt, einem Spezialisten für Rückenschmerzen, die Auskunft erhielt, dass ihr Rücken keine körperlichen Schäden aufweist, begann sie langsam wieder mit dem Tanzen. Sie arbeitete mit einem Psychotherapeuten zusammen, der auf Schmerzerkrankungen spezialisiert ist. Außerdem begann sie selbstständig mit Übungen zum Brain Retraining und zur Regulierung des Nervensystems. Und ihre Welt wurde wieder größer.
Dabei waren ihre Symptome echt, betont Grete. "Es ist nichts eingebildet." Auch Rebecca ärgert sich über dieses immer noch verbreitete Missverständnis und wünscht sich mehr Verständnis für funktionelle Erkrankungen. Denn das Unverständnis, dass Betroffenen von Angehörigen und teilweise auch Ärzten entgegengebracht wird, kann zur enormen Belastung werden.
"Leider gibt es bei chronischen Schmerzpatienten eine erhöhte Suizidrate", bestätigt Hausteiner-Wiehle. Dabei ist die Chance auf Verbesserung und Heilung bei einer angemessenen Behandlung gut. So wie bei Grete. Sie hat heute keine chronischen Rückenschmerzen mehr und unterstützt als Heilpraktikerin für Psychotherapie andere Menschen mit psychosomatischen Beschwerden.
Auch Rebecca hat einen Weg gefunden, mit ihrem Reizdarmsyndrom zu leben. Mithilfe einer Psychotherapie und zeitweise einem Antidepressivum ist sie zwar nicht vollkommen frei von Beschwerden. Aber sie weiß jetzt, was ihre Symptome auslöst und kann wieder am Leben teilnehmen. Nachdem sie zu Beginn ihrer Erkrankung über ein Jahr nicht in die Schule gehen konnte, wird sie im Sommer ihre Ausbildung beenden.
-
Antwort auf negative Kritik an meinen Kommentaren
Sehr geehrte Frau XY,
es tut mir leid, wenn ich Sie mit meinen Ausführungen so stark erregt haben sollte, dass Sie sich zu einer solch emotionalen Stellungnahme genötigt fühlten.
Es ist bemerkenswert, dass ausgerechnet Sie als Lehrerin meine Anmerkung zur allgemeinen Gesundheitserziehung so persönlich genommen haben.
Und ja, auch wir hatten einige Zeit Mitarbeiterinnen, die empathischer und Stress-resistenter hätten sein können. Aber wir leben in einer Zeit des Fachkräftemangels und können es uns leider nicht leisten, allzu wählerisch zu sein. Mittlerweile habe wir wieder ein sehr sympathisches harmonisches Team!
Auch Ihnen wird nicht entgangen sein, dass verstärkt nach der Corona-Pandemie die Freundlichkeit/ Gelassenheit vieler Menschen zueinander abgenommen und die Anspruchshaltung/ Ungeduld zugenommen haben.
Solch ein Kommentar kann nur ein grober Bogen über viele Themengebiete sein, die uns alle belasten. Über jedes Themengebiet könnte man lange diskutieren.
Mein Ziel ist es, den Patient:innen ein gewisses Verständnis dafür zu vermitteln, warum einige Abläufe und Einschränkungen so sind wie sie sind. Und dass das perfekte deutsche Gesundheitswesen nicht mehr so großartig ist, wie uns viele Politiker in Talkshows glauben machen wollen (egal welcher Partei).
Erfreulicherweise kann ich Ihnen mitteilen, dass Sie mit Ihrer verärgerten ablehnenden Reaktion extrem alleine sind. Ich erlebe nahezu täglich genau die entgegengesetzte wohlwollende Reaktion!
Patient:innen drücken nahezu ausnahmslos ihr Interesse und ihre Zustimmung aus.
Viele bedanken sich auch für die Erläuterungen, weil sie solche Details zu Budgetierungen, Pauschalen, Praxisfinanzierung, Hintergründe zu diversen Einschränkungen gar nicht kannten. Dort ist mein Bestreben nach Aufklärung verstanden worden.
Mit freundlichen Grüßen,
Dr. Martin Mundo
-
Kommentar zur Meldung "Lauterbach will bessere Bedingungen für Hausärzte" im Weser-Kurier 29.06.2024
Die Ankündigung des Bundesgesundheitsministers, durch die Entbudgetierung die Vergütung der Hausärzte verbessern zu wollen, macht oberflächlich einen guten Eindruck.
Aber damit wird man den zahlreichen, gravierenden, komplexen Probleme der kassenärztlichen Gesundheitsversorgung Deutschlands keinesfalls gerecht.
Die Praxen arbeiten am obersten Limit.
Mehr geht nicht - und sonst würden uns noch mehr Medizinische Fachangestellte überlastet frustriert davonlaufen.
Wie bei den Kinderärzten folgt das gleiche Prinzip nun bei den Hausärzten: Wer am lautesten brüllt, bekommt ein kleines Geschenk zur Besänftigung.
Warum werden die Fachärzte explizit - und offensichtlich bewusst kalkuliert - von diesen Verbesserungen ausgenommen?
Meine Arbeit als Orthopäde besteht zu 3/4 aus Behandlungen von degenerativen arthrotischen Beschwerden am Bewegungsapparat der zunehmend alternden Bevölkerung.
Da gibt es keinerlei Unterschiede zur Hausärztlichen Grundversorgung.
Warum gelten für uns Orthopäden die Chroniker-Regeln nicht?
Es wäre für mich nicht nachvollziehbar und den Patienten nicht vermittelbar, warum für uns andere/ schlechtere Regeln gelten.
Herr Lauterbach betreibt zum wiederholten Mal die perfide Taktik, Keile zwischen die Arztgruppen zu treiben und sie so in kleine unbedeutende Grüppchen zu zersplittern.
Der wahre Masterplan unserer Gesundheitspolitik sieht mittelfristig so aus, die Inhaber-geführten Facharztpraxen allmählich auszutrocknen und sie dann in den Krankenhäusern angegliederte Primärversorgungszentren zu überführen.
Damit wird das persönliche Arzt-Patienten-Vertrauensverhältnis beerdigt.
Nur als große Gesamtheit sind wir Ärzte stark und können uns wehren!
Ich hoffe sehr, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung als unsere Interessensvertreter dieser halbherzigen Schachzug-Politik eine ganz deutliche Absage erteilt und endlich stärker und öffentlichkeitswirksamer auftritt.
Dr. Martin Mundo
-
Kommentar zum Artikel "Ich bin frustriert und abgenervt" im Weser-Kurier 07.06.2024
Ich danke dem Kollegen Malak ausdrücklich für dieses Interview.
Die benannten Probleme von Arztpraxen kann ich vollumfänglich bestätigen.
Es ist für den zukünftigen Erhalt der Arztpraxen überlebenswichtig, das mediale und gesellschaftliche Bewusstsein für diese Missstände zu schärfen.
Der Begriff "Scheinselbständigkeit" beschreibt unsere Situation sehr zutreffend.
Niedergelassene Kassenärzte sind durch zahlreiche Reglementierungen in ihrer Leistungserbringung eingeschränkt und hinsichtlich der Einnahmen gedeckelt.
Die Gebührenordnungen sind veraltet, Anpassungen sind deutlich unter der allgemeinen Kostensteigerung geblieben.
Woher soll das Geld kommen, um z.B. die berechtigterweise stark gestiegenen Gehälter der Medizinischen Fachangestellten zu bezahlen?
Die Schieflage zwischen ständig zunehmenden Praxis-Ausgaben und stagnierenden -Einnahmen verschärft sich immer mehr.
Man braucht sich nicht zu wundern, dass junge Ärzte die Selbständigkeit scheuen und keine Praxen mehr übernehmen wollen.
Mehr und mehr werden Praxen schließen.
Die Gesundheitspolitik stützt einseitig die Krankenhäuser, wo Primärversorgungszentren anstelle der Inhaber-geführten Praxen entstehen sollen.
Das persönliche Arzt-Patienten-Vertrauensverhältnis wird damit aufgegeben.
Man darf auch nicht vergessen, dass Ärzte ein langes Studium, das spärlich bezahlte Arzt-im-Praktikum und die fachärztliche Weiterbildung als mäßig bezahlter Assistenzarzt im Krankenhaus hinter sich haben.
Wir mussten unseren Arbeitsplatz kaufen, dass heißt dem Praxis-Vorgänger eine Ablösesumme zahlen (was ein wichtiger Baustein zur Altersversorgung ist).
Unsere Arbeitszeiten, die Verantwortung und das betriebliche Risiko sind wesentlich höher als bei angestellt Arbeitenden.
Da muss die Praxis auch eine entsprechenden Erlös erwirtschaften, damit ein angemessener Lebensarbeitsertrag gebildet werden kann.
Wir erleben, dass dieses System gerade zusammenbricht.
Immer mehr Kollegen geben frustriert auf und verkaufen ihre Praxen an Betreibergesellschaften von Medizinischen Versorgungszentren.
Diese Kassenärztlichen Sitze sind dann für immer aus dem Pool der selbständigen Ärzte verloren gegangen.
Die Gesundheitsversorgung in Deutschland schrumpft.
"Die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten" (GKV-Leitlinie).
Es ist ein Märchen, dass alle Patienten in Deutschland die gleiche bestmögliche Gesundheitsversorgung erhalten würden.
Das Leistungsspektrum privater Krankenversicherungen ist nicht budgetiert. Behandlungen werden im Quartal so oft bezahlt, wie sie medizinisch notwendig sind.
Auch hochwirksame Therapieverfahren werden übernommen, die die gesetzlichen Kassen ausschließen.
Es ist dringend erforderlich, die Patientenströme intelligent zu steuern, um die Ressourcen optimal nutzen zu können.
Viele Behandlungen ließen sich schon durch eine gewisse gesundheitliche Grundbildung vermeiden, wie sie früher von den Eltern gelehrt wurde. Vielleicht muss diese Aufgabe zukünftig die Schule übernehmen.
Auch das Ärztehopping, bis der Patient die von ihm gewünschte Verordnung bekommt, erleben wir arbeitstäglich.
Die Verrohung im gesellschaftlichen Miteinander mit aggressivem Verhalten ist ein gravierendes Problem geworden und macht heutzutage ein Deeskalationstraining für das Team erforderlich.
Es gibt viel und dringenden Handlungsbedarf seitens der Gesundheitspolitik unseres Landes, um die Inhaber-geführten Praxen für die Zukunft zu stärken und so zu erhalten.
Dr. Martin Mundo
-
Pressemitteilung BVOU 07.05.2024
Keine Facharztpraxis mehr für Kassenpatienten?
Gesetzlich Versicherten droht neues Ungemach:
Schon jetzt ist es in vielen Regionen schwierig bis nahezu unmöglich, zeitnahe Termine bei Fachärzten für Gynäkologie, HNO, Radiologie oder Orthopädie und Unfallchirurgie zu bekommen.
Die Gründe hierfür sind vielfältig: Budgets begrenzen die Fallzahlen im Quartal, Mitarbeitermangel, fehlende Praxisnachfolger sind nur einige davon.
Zur Lösung des Problems empfiehlt die Regierungskommission, dass fast alle fachärztlichen Behandlungen nur noch an oder gemeinsam mit Krankenhäusern stattfinden sollen.
Zeitgleich verfolgt die Regierung das erklärte Ziel die Anzahl der Krankenhäuser um circa zwei Drittel zu reduzieren:
Lange Wartezeiten auf einen Termin beim Facharzt drohen wie bereits in England oder Schweden – sowie das Ende der Klinik vor Ort.
Weiterhin sollen Primärversorgungszentren statt hausärztliche Praxen entstehen, die Krankenhäuser werden für die hausärztliche Versorgung geöffnet – das bedeutet das Ende der persönlichen Betreuung durch den Hausarzt.
Vertreter aus Klinik und Praxis warnen:
„Die Wartezeiten für Kassenpatienten sind in vielen Bereichen und Regionen schon jetzt nicht mehr akzeptabel. Frauen finden keinen betreuenden Gynäkologen, Termine für eine MRT sind im Quartal nicht mehr zu bekommen – nur um Beispiele zu nennen.
Auch in meiner orthopädischen Praxis stehen wir vor enormen Herausforderungen bei der Terminvergabe – die Mitarbeiter sind am Anschlag“, so Dr. Burkhard Lembeck, Präsident des Berufsverbandes für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU).
Kooperation von haus- und fachärztlichen Praxen
„Statt auf planwirtschaftliche Lösungen, bauen wir auf bessere Steuerung und Weiterentwicklung eines Systems von leistungsfähigen, inhabergeführten Haus- und Facharztpraxen. Nur dieses schlanke System kann es leisten, den jetzigen Versorgungsgrad einigermaßen aufrecht zu erhalten. Wer einmal mit der Versorgungsrealität in England, Schweden oder sonstigen Teilen der EU konfrontiert war, weiß, wovon ich spreche“, mahnt der BVOU-Präsident.
Fachärztliche Termine nur über Beziehungen oder gegen Barzahlung – das kann nicht die Perspektive für Deutschland sein.“
Als Lösungsbeispiel führt er das Modell von Haus- und Facharztverträgen in Baden-Württemberg an.
Die Ärzte stehen hier für ein koordiniertes Miteinander von haus- und fachärztlichen Praxen.
Hausärzteverband: Abschaffung von doppelter Facharztschiene ist eine Hiobsbotschaft
„Die Sicherstellung der ambulanten Versorgung durch Haus- und Fachärzte ist das Fundament unseres Gesundheitswesens.
Die Hausärzte sind dabei die erste Anlaufstelle, die viele Anliegen bereits abschließend klären und den Versorgungsprozess koordinieren.
In den Fällen, bei denen die Patienten auf die fachärztliche Expertise angewiesen sind, braucht es schnelle und koordinierte Prozesse.
Das geht nur, wenn es eine wohnortnahe und niedrigschwellige Versorgung gibt!
Das können Krankenhäuser nicht leisten.
Deswegen sind wir klar gegen die pauschale Verlagerung von hausärztlichen und fachärztlichen Aufgaben in die Krankenhäuser, die nach eigener Aussage sowieso schon überfordert sind“, so Prof. Dr. Nicola Buhlinger Göpfarth, Vorständin des Hausärzteverbandes-Deutschland.
Sie erklärt weiter:
„Die komplette Abschaffung der doppelten Facharztschiene wäre daher für die Patienten eine echte Hiobsbotschaft. Die Folge wäre, dass Millionen Patienten ständig in weit entfernte Kliniken müssten, statt wohnortnah versorgt zu werden. Wer so etwas fordert, der ist sich entweder der Auswirkungen nicht bewusst oder nimmt sie sogar billigend in Kauf. Wie es besser geht, zeigen wir in den Verträgen zur hausarztzentrierten Versorgung. Durch die Anbindung der Facharztverträge stellen wir ein koordiniertes und effizientes Miteinander sicher – und das bei deutlich besserer Qualität. Das sollte der Weg in die Zukunft sein.“
DGOU und BVOU setzen auf intelligente Patientensteuerung
Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) setzt auf bessere Abstimmung und Steuerung des bestehenden Netzwerks an ambulanten und stationären Ressourcen – sowohl bei elektiven Eingriffen als auch in der Notfallversorgung.
Für die Notfallversorgung haben DGOU und BVOU in einem gemeinsamen Positionspapier bereits 2022 formuliert, wie die Herausforderungen durch eine intelligente Patientensteuerung gemeistert werden können.
Die Regierung agiert jedoch wiederholt am Patienten und an der Wirklichkeit vorbei.
„Die Regierungskommission hat unter ihren Mitgliedern im chirurgischen Bereich keine Kompetenz versammelt. Dementsprechend sehen die Koalition und der Gesundheitsminister als einfachstes Instrument eine breite Kürzung mit einem Kahlschlag bei Kliniken und Praxen mit schwerem Schaden für die noch funktionierende Kooperation über die Sektoren“, erklärt DGOU-Generalsekretär Prof. Dr. Dietmar Pennig. „Kahlschlag bei den Kliniken, Schließung der fachärztlichen Praxen – wer versorgt dann in naher Zukunft flächendeckend die alternde Bevölkerung bei steigendem Versorgungsbedarf, beispielsweise bei osteoporotischen Frakturen?“
Über den BVOU:
Der Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. (BVOU) ist die berufspolitische Vertretung für mehr als 7.000 in Praxis und Klinik tätige Kollegen und Kolleginnen. Der BVOU setzt die beruflichen Interessen seiner Mitglieder durch, indem er zum Vorteil der Patienten und des Gemeinwohls gemeinsam mit den wissenschaftlichen Gesellschaften den Standard orthopädisch-unfallchirurgischer Versorgung entwickelt, die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen prägt und dadurch die öffentliche Wahrnehmung seiner Mitglieder als Experten für orthopädisch-unfallchirurgische Versorgung gestaltet.
-
Artikel "Der nächste freie Arzttermin ist bitte wann?" vom 23.01.2024
Artikel von Silke Jäger, Krautreporter, 23.01.2024:
Der nächste freie Arzttermin ist bitte wann?!
In Deutschland soll niemand länger als vier Wochen auf einen Arzttermin warten. Die Realität sieht anders aus. Das kannst du tun, um schneller an einen Termin zu kommen.
„Meine Hausarztpraxis lässt seit circa zwei Wochen das Band laufen, niemand da, der das Telefon abnehmen könnte. Alle krank.“
„Ich komme bei meiner Hausärztin nicht mal telefonisch durch, um ein neues Asthma-Medikament zu bestellen.“
„Bin vor sechs Wochen umgezogen und versuche seit fünf Wochen eine Praxis zu finden, die mir nur mal eine Impfung verpasst. Den Gedanken, mir einen Hausarzt zu suchen, bevor ich krank werde, versuche ich seitdem zu verdrängen.“
Das schreiben drei Teilnehmer:innen meiner Umfrage. Ich wollte wissen, ob ihr schnell genug Arzttermine bekommt und welche Erfahrungen ihr mit der Terminvergabe in Arztpraxen macht. Fast 500 KR-Leser:innen haben mir geantwortet.
70 Prozent der Teilnehmer:innen finden, dass es in letzter Zeit schwieriger geworden ist, einen Arzttermin zu bekommen. Das frustriert nicht nur die Patient:innen. Auch die Menschen, die in den Arztpraxen arbeiten, werden krank und sind unzufrieden, wenn das Telefon ständig klingelt und sie nicht rangehen können, die Wartezimmer überquellen und sie befürchten müssen, dass schwer kranke Menschen nicht rechtzeitig medizinische Hilfe bekommen.
Um die Ursachen dieses Missstands besser zu verstehen, muss man (mal wieder) dem Gesundheitswesen etwas tiefer in die Augen schauen. Klar ist schon jetzt: In unserer Gesellschaft leben immer mehr alte Menschen. Diese haben häufiger gesundheitliche Beschwerden als jüngere. Außerdem nimmt die Zahl der chronisch kranken Menschen zu, auch weil Krankheiten, die früher tödlich waren, jetzt besser behandelt werden können. Weil es gleichzeitig weniger Nachwuchs in medizinischen Berufen gibt, wird es schwieriger, sich um alle zu kümmern, die medizinische Hilfe brauchen. Ich habe aber noch fünf weitere Gründe für die langen Wartezeiten gefunden.
Und ich habe mich auch gefragt: Was tut die Politik dafür, dass es besser wird – und was die Ärzt:innen und Krankenkassen?
Bekommen Privatpatient:innen tatsächlich schneller einen Termin? Und wie kommst du besser an einen Arzttermin? Darum geht es in diesem ersten Text meiner neuen Serie „Deine Gesundheit und das System“.
Ursache 1: Hier sind zu wenig Ärzt:innen, dort zu viele
In einigen Regionen Deutschlands ist es deutlich schwieriger, einen Termin beim Hausarzt zu bekommen, als in anderen. Das betrifft vor allem die ländlichen, dünn besiedelten Räume. In anderen Regionen gibt es rein rechnerisch sogar zu viele Ärzt:innen.
Diese Unterschiede spiegeln sich auch in meiner Umfrage wider. Teilnehmer:innen, die in einer großen Stadt leben, beklagten seltener Probleme mit Arztterminen. Auf dem Land kann man nicht mal eben zu einer anderen Praxis gehen, weil die Wege sehr weit sein können.
Ursache 2: Weniger Ärzt:innen lassen sich nieder, mehr scheiden aus
KR-Leserin Birgit fragt sich: „Haben wir in Deutschland zu wenig niedergelassene Ärzte?“ Die Frage ist berechtigt. Der Hausärzteverband meldet zurzeit tatsächlich 5.000 nicht besetzte Hausarzt-Sitze in Deutschland. Im Jahr 2035 könnten es mehr als doppelt so viele sein, zeigt eine Studie der Robert Bosch Stiftung. Der Hauptgrund dafür ist neben fehlenden Medizinstudienplätzen der demografische Wandel. Damit ist nicht nur gemeint, dass viele Ärzt:innen in den Ruhestand gehen und zu wenig Hausarztnachwuchs nachrückt. Unter den demografischen Wandel fallen noch andere Phänomene.
Heute entscheiden sich beispielsweise mehr Frauen, Ärztin zu werden. Und jüngeren Menschen ist eine gesunde Work-Life-Balance wichtiger. Beides sorgt dafür, dass weniger Ärzt:innen bereit sind, die früher üblichen Arbeitszeiten von bis zu 60 Stunden pro Woche zu akzeptieren. Immer mehr Ärzt:innen wollen angestellt arbeiten – und in Teilzeit.
Dazu kommt, dass es immer teurer wird, eine Praxis zu eröffnen. Das ist oft zu teuer für einen allein. Und das hat Folgen: 2013 arbeiteten fast 58 Prozent der Hausärzt:innen in einer Einzelarztpraxis, 2022 waren es laut Kassenärztlicher Vereinigung schon circa vier Prozent weniger. Andere Betriebsformen werden unter Ärzt:innen immer beliebter, zum Beispiel Gemeinschaftspraxen und Medizinische Versorgungszentren. Fast die Hälfte aller ambulant tätigen Ärzt:innen arbeitet inzwischen angestellt, in einigen Fachrichtungen, wie zum Beispiel in der Radiologie, sind es über 90 Prozent – Tendenz steigend.
Wenn es weniger Praxen gibt und mehr Ärzt:innen weniger arbeiten, kann es dazu führen, dass du länger auf deinen Termin warten musst.
Ursache 3: Es gibt Ärger mit den Honoraren, Probleme mit der Inflation
Seit 2007 dürfen Ärzt:innen nicht unbegrenzt Medikamente und Therapien verschreiben. Wie viel sie ausgeben dürfen, ist festgelegt. Und die Einnahmen aller niedergelassenen Ärzt:innen sind gedeckelt. Das nennt sich Budgetierung. Sie soll dafür sorgen, dass die Ausgaben der Krankenkassen nicht unkontrolliert steigen.
In der Praxis sorgt die Budgetierung dafür, dass Ärzt:innen für einen Teil ihrer Arbeit kein Geld bekommen. Der Ärzteverband Virchow-Bund schätzt, dass im Durchschnitt ein Fünftel der Arbeit unbezahlt bleibt. Das Budget wird dabei quartalsweise berechnet. Die Pauschalen, die die Kasse pro Patient:in zahlt, unterscheiden sich je nach medizinischem Problem. Außerdem dürfen Ärzt:innen nur einen gewissen Betrag für Medikamente, Heil- und Hilfsmittel ausgeben. Wer als Ärzt:in die Krankenkassen über das vorgesehene Budget hinaus belastet, muss das aus seinem Privatvermögen zurückzahlen. Diese sogenannten Regresse sind bei Ärzt:innen sehr gefürchtet.
Für Arztpraxen sind die Honorare der Krankenkassen in den vergangenen Jahren kaum gestiegen, zuletzt gab es eine Erhöhung um knapp vier Prozent. Durch die Inflation und die Energiekrise stiegen aber die Kosten in dieser Zeit stärker. Dadurch verdienten Praxisinhaber:innen weniger und hatten auch weniger Geld für Personal und Anschaffungen zur Verfügung. Auch die Digitalisierung kostet Geld, das die Praxen nur zum Teil erstattet bekommen. Außerdem müssen sie mit Sanktionen rechnen, wenn sie die Digitalisierung nicht so umsetzen, wie das Bundesgesundheitsministerium es vorschreibt.
Last but not least: Anfang 2023 wurde eine Regelung gestrichen, die für viele Praxen finanziell attraktiv war: die Neupatientenregelung. Praxen bekamen einen Bonus für Patient:innen, die sie neu in ihre Kartei aufgenommen hatten. So wurde der Mehraufwand ausgeglichen, der durch das Kennenlernen entsteht.
All das sorgt dafür, dass Ärzt:innen zum einen versuchen, seltener unbezahlt zu arbeiten und zum anderen mit weniger Stress. Sich um alle zu kümmern, die medizinische Hilfe brauchen, entwickelt sich immer mehr zu einer Utopie. Damit sie selbst gesund bleiben, begrenzen viele ihre Arbeitszeit, so wie KR-Leser Florian.
Florian ist Hausarzt in Schleswig-Holstein. Er hat zusammen mit einem Kollegen eine Praxis in Barmstadt, einer Kleinstadt in einer dünn besiedelten Gegend. Am Anfang arbeitete er oft bis neun Uhr abends. Inzwischen versucht er meistens, um sieben zu Hause zu sein, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. In der Mittagspause macht er Hausbesuche. Damit das klappt, nimmt er keine neuen Patient:innen mehr an. Das aber ist für die Kommune ein Problem, denn dort entstanden in den vergangenen Jahren ein neues Pflegeheim, mehrere betreute Senior:innen-WGs und eine große Wohnanlage für betreutes Wohnen von Senior:innen. Florian sagt: „Niemand hat sich vorher mit den Ärzt:innen hier vor Ort zusammengesetzt und überlegt, wie die ärztliche Versorgung für die Einrichtungen aussehen kann.“
Ursache 4: Zu viel Stress sorgt dafür, dass Praxispersonal aufgibt
Medizinische Fachangestellte (MFA, früher: Arzthelfer:in) gehört zu den beliebtesten Ausbildungsberufen unter jungen Frauen. Er gehört aber auch zu den Ausbildungen, die am häufigsten abgebrochen werden. Und er gehört zu den sogenannten Mangelberufen – also jenen, in denen mehr Leute gebraucht werden, als arbeiten wollen. Auch in diesem Beruf schlägt der demografische Wandel zu.
Aber es rächt sich auch, dass Arztpraxen ihre Mitarbeiter:innen nicht sonderlich gut bezahlen. Immer mehr MFA wandern in Krankenhäuser ab, die mehr für sie ausgeben können.
Der Stress war in den Pandemiejahren für das Praxispersonal besonders groß. Aber es häufen sich weiterhin Berichte über Bedrohungen und Angriffe von Patient:innen.
Viele MFA verlassen den Beruf oder werden dauerhaft krank. Die Personalnot bringt Praxisabläufe ins Stocken. So kann es vorkommen, dass man in einer Praxis anruft und gefühlt stundenlang niemand ans Telefon geht.
Ursache 5: Patient:innen gehen vorschnell zum Arzt, weil sie zu wenig über Gesundheit wissen
Immer mehr Menschen suchen medizinischen Rat, weil sie bei eigentlich einfachen Gesundheitsfragen unsicher sind. Die Gesundheitskompetenz hinkt in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern hinterher. Fast 60 Prozent der Befragten schätzen ihr Wissen darüber, wo sie verlässliche Gesundheitsinfos finden, wie sie sie bewerten und auf ihre eigene Situation anwenden können, als eher schlecht oder sehr schlecht ein.
Wer zum Beispiel nicht weiß, wann Fieber beim Kind gefährlich werden kann, mit welchen Mitteln man es senkt und wo man nachsehen kann, wenn man sich damit nicht auskennt, geht vorsichtshalber lieber zum Arzt. Die Folge: Wartezimmer quellen über. Das Problem bekommen auch die Notaufnahmen zu spüren.
Wirksame Konzepte, wie sich die Gesundheitskompetenz verbessern lässt, gibt es längst – übrigens nicht für Patient:innen. Auch Krankenhäuser, Praxen und Pflegeheime müssen besser darin werden, Mitarbeiter:innen und Patient:innen dabei zu unterstützen, gesundheitskompetent zu handeln.
Auch Ärzt:innen sind unzufrieden
Die Folge von all dem ist, dass viele Praxen viel Stress haben und eher pessimistisch in die Zukunft schauen. Eine repräsentative Umfrage der Stiftung Gesundheit unter 781 Ärzt:innen kam Anfang Oktober 2023 zu dem Ergebnis, dass die Stimmung so schlecht wie noch nie ist, seit das Stimmungsbarometer im Jahr 2006 startete. Vor allem Fachärzt:innen beklagen die Lage und haben negative Zukunftserwartungen.
Zwischen den Jahren waren einige Arztpraxen einem Aufruf des Ärzteverbands Virchow-Bund gefolgt und hatten aus Protest gegen die Gesundheitspolitik ihre Praxen geschlossen. Auf der Website "Praxis in Not" ruft der Virchow-Bund weiterhin zu Protesten auf. Dazu gehören auch solche, die dazu führen würden, dass es noch schwieriger wird, an Arzttermine zu kommen, wie zum Beispiel weniger Sprechzeiten.
Was die Gesundheitspolitik gegen lange Wartezeiten tut
Laut Gesetz sollen Patient:innen innerhalb von vier Wochen einen Arzttermin bekommen. Das gilt auch für U-Untersuchungen bei Kindern. Ein Termin bei Psychotherapeut:innen soll sogar innerhalb von zwei Wochen möglich sein. Viel zu oft klappt das nicht.
Im Jahr 2019 verpflichtete der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Arztpraxen dazu, jede Woche 25 Stunden Sprechstunde anzubieten. Vorher waren es nur 20. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bereitet gerade große Reformen vor. Was das für die Wartezeiten auf Termine bedeutet, muss man abwarten.
Lauterbach will dem Kabinett aber noch im Januar ein Gesetz vorstellen, das einige Forderungen der Ärzt:innen erfüllt. Für Hausärzt:innen sollen die Budgetierung und damit auch die Regresse abgeschafft werden. Für chronisch kranke Patient:innen, die regelmäßig ärztliche Betreuung und Medikamente brauchen, sollen Praxen eine Jahrespauschale bekommen. Und Praxen, die besonders viele Patient:innen versorgen, sollen dafür einen Bonus erhalten. Für Facharztpraxen will der Minister im Laufe des Jahres Vorschläge machen. Außerdem will er 5.000 neue Medizinstudienplätze schaffen, und die Student:innen sollten teilweise dazu verpflichtet werden, sich auf dem Land niederzulassen.
Kommen Privatpatient:innen wirklich schneller dran?
Bis die Pläne der Gesundheitspolitik greifen, kann es noch einige Zeit dauern. Bis dahin kannst du schon selbst einiges dafür tun, dass du nicht so lange auf einen Termin warten musst. Vielleicht denkst du jetzt: Naja, Privatpatient:in müsste man sein. In meiner Umfrage haben tatsächlich mehr als zehn Prozent angegeben, schneller dranzukommen, wenn sie sagen, privat versichert zu sein. Manche berichteten auch davon, dass Praxen eigene Telefonnummern für privat Versicherte haben. Andere sagten, sie würden nach ihrem Versicherungsstatus gefragt, bevor man ihnen ein Terminangebot macht. Und einige gesetzlich Versicherte wurden auch direkt abgewimmelt. Vor allem Facharztpraxen scheinen öfter mal den Versichertenstatus medizinischen Kriterien vorzuziehen.
Eine Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts stellt fest, dass im Jahr 2020 privat Versicherte schneller an einen Termin kamen als gesetzlich Versicherte. Dagegen schließt die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) aus Umfragen, dass die Wartezeiten zwar variieren, es aber keine nennenswerten Unterschiede bei der Terminvergabe gibt. Zwei Drittel der Versicherten seien zufrieden mit den Wartezeiten.
Besonders schwer haben es übrigens People of Colour und Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Im November 2023 kam der erste Nationale Diskriminierungs- und Rassismusmonitor zum Ergebnis, dass rassistisch markierte Personen schwerer an Termine kommen und weniger Gehör für medizinische Probleme finden. Sie gaben doppelt so häufig wie der Rest der Bevölkerung an, aus Angst vor Schlechterbehandlung später oder gar nicht zum Arzt zu gehen.
Was du selbst tun kannst, um schneller an einen Termin zu kommen
Wenn es mal wieder etwas länger dauert mit einem Termin, hast du verschiedene Möglichkeiten. Die Teilnehmer:innen meiner Umfrage empfehlen zum Beispiel, hartnäckig zu bleiben und immer wieder in Praxen anzurufen. Sie haben auch gute Erfahrungen damit gemacht, bei akuten Problemen sehr früh morgens, noch bevor die Sprechstunde offiziell beginnt, zur Praxis zu gehen und sich schon mal anzustellen. Oder sie setzen sich in die offene Sprechstunde und stellen sich darauf ein, dass sie an diesem Tag lange warten müssen, bis sie drankommen. Außerdem rufen manche nicht an, sondern schreiben eine E-Mail. Das kann funktionieren, weil viele Praxen feste Terminslots für unterschiedliche Anfragearten vorhalten. Wenn die Termine für Telefonanfragen vergeben sind, können immer noch welche im Online-Kalender frei sein.
Ich habe außerdem sechs weitere Möglichkeiten gefunden, wie du die Sache beschleunigen kannst. Das steht dir gesetzlich zu:
1. Terminservicestellen sind unter der Nummer 116 117 rund um die Uhr an sieben Tagen pro Woche im gesamten Bundesgebiet erreichbar. Sie helfen bei der Suche nach einem freien Arzttermin – allerdings nicht unbedingt beim Wunscharzt oder der Lieblingsärztin. Mit einem Vermittlungscode funktioniert das auch online. Dieser Code steht entweder auf dem Überweisungsschein aus der Hausarztpraxis oder kann bei den Terminservicestellen angefordert werden.
Sollten dir die Servicestellen nicht innerhalb von vier Wochen erfolgreich einen Termin vermitteln können, kannst du auch einen Termin für eine ambulante Behandlung in einem Krankenhaus bekommen. Auch für diese Termine unterstützen dich rein theoretisch die Terminservicestellen. Das klappt laut Unabhängiger Patientenberatung Deutschland aber nicht besonders gut. Die Mitarbeiter:innen der Servicestellen wissen offenbar oft selbst nicht immer über diese Möglichkeit Bescheid.
2. Facharztpraxen müssen auch kurzfristige Termine freihalten. Wenn sie zur Grundversorgung zählen, sind sie verpflichtet, fünf Termine pro Woche als offene Sprechstunde anzubieten. Zur Grundversorgung zählen zum Beispiel Augenarzt-, Hals-Nasen-Ohren-Arzt- oder Frauenarztpraxen.
3. Einige Krankenkassen helfen bei der Terminsuche. Als zusätzlichen Service verschicken manche sogar SMS zur Erinnerung kurz vor dem Termin.
4. Kassenärztliche Vereinigungen (KVen) bieten Unterstützung bei der Terminvereinbarung mit Facharztpraxen an. Je nach Region sind unterschiedliche KVen zuständig.
5. Auch private Online-Portale können dir helfen. Zum Teil nutzen Arztpraxen diese Buchungstools sogar selbst, um die Terminvergabe an Patient:innen zu vereinfachen. Manchmal gibt es aber Datenschutz-Probleme, zum Beispiel mit Doctolib.
6. Auch ein Termin in einer Videosprechstunde kann eine Alternative sein. Die Verbraucherzentralen machen jedoch darauf aufmerksam, dass diese Angebote nicht immer datenschutzkonform sind.
-
Kommentar zum Artikel "Ärzte diskutieren Vier-Tage-Woche" im Weser-Kurier 07./08.01.2023
Die Vertreter der gesetzlichen Krankenversicherungen behaupten, Praxisinhaber würden einen durchschnittlichen Rein-Ertrag von deutlich mehr als 215.000€ erzielen. Damit verfolgen sie wieder die Strategie, die Ärzte als die Wohlhabenden zu diffamieren, die unberechtigt auf hohem Niveau jammern würden.
Mit dieser schlichten Taktik wird man den multiplen komplexen Problemen der Praxen absolut nicht gerecht.
Zunächst einmal muss die Entstehung dieser rein statistischen Zahl sehr kritisch hinterfragt werden. Bekanntermaßen kann man mit Statistik auch zu merkwürdigen Aussagen kommen. Wie definiert man dort "Rein-Ertrag" eigentlich?
Ich kann diese Zahl in der Realität nicht bestätigen, insbesondere nicht aus den Erlösen der gesetzlichen Krankenversicherungen, und bin offenbar unterdurchschnittlich.
Bundesgesundheitsminister Spahn hatte 2019 die Neupatientenregelung ins Leben gerufen. Sie bestand aus Forderungen (z.B. Offene Sprechzeiten), die aber auch mit finanziellen Anreizen (extrabudgetäre Vergütung) versüßt wurden.
Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat nun diese Neupatientenregelung wieder zurückgenommen. Die Mehrbelastungen sind geblieben, die Mehrvergütungen wurden gestrichen.
Von der Kassenärztlichen Vereinigung bekommen Ärzte für ein Quartal ein Budget zugewiesen, was sich an der Patientenzahl im Vergleichsquartal des Vorjahrs orientiert. Ist diese Obergrenze erreicht, und behandelt der Arzt Neupatienten darüber hinaus, droht eine Herabstufung der Vergütung.
Es macht also betriebswirtschaftlich keinen Sinn bzw ist schädlich, weitere Patienten zu behandeln.
Gibt es in der Marktwirtschaft noch andere selbständige Betriebe, bei denen man eine Deckelung der Einnahmen vorschreibt?
Die Ausgaben sind seit Jahren ohne entsprechenden Ausgleich angestiegen.
Bei den Honorarverhandlungen wollten die Kassenvertreter Nullrunden für 2023, 2024 und 2025 durchsetzen.
Im zähen Schlichtungsverfahren kam schließlich ein mageres Plus von 2% heraus.
Dies ist angesichts der Inflation von 10%, rasant gestiegener Kosten für Wärme und Strom sowie der Gehaltssteigerungen beim Tarifvertrag der Medizinischen Fachangestellten in den letzten Jahren von rund 30% für die Praxisinhaber ein gravierendes Minus ihres Einkommens.
Die Kassenvertreter argumentieren, dass die Praxen diese Mehraufwendungen aus den Wirtschaftlichkeitsreserven alleine zu bewältigen hätten. Glaubt man ernsthaft, dass die Praxen über prall gefüllte Bankkonten verfügen?
Die Stimmung in unserer Gesellschaft ist spürbar rauer geworden. Von schlechtem Benehmen über Beschimpfungen bis hin zu aggressivem Verhalten müssen Medizinische Fachangestellte nahezu täglich einiges ertragen. Es verwundert nicht, dass viele frustriert den Beruf aufgeben.
Hoher Krankenstand und massiver Fachkräftemangel führen dazu, dass die Praxen oft mit minimaler personeller Besetzung funktionieren müssen.
Häufig werden die schlechte telefonische Erreichbarkeit sowie lange Wartezeiten zum Termin oder vor dem Sprechzimmer kritisiert.
Die Patienten müssen sich leider damit abfinden, dass auf der anderen Seite des Empfangstresens immer weniger Personal arbeitet.
Auch in meinem Praxisumfeld in Schwachhausen haben in den letzten Jahren mehrere Hausarztpraxen geschlossen, weil der in den Ruhestand tretende Kollege keinen Nachfolger finden konnte.
Es ist ein besorgniserregendes, alarmierendes Zeichen, wenn sogar an "guten Standorten" die Praxen so unattraktiv geworden sind, dass sich keine niederlassungswilligen jungen Ärzte mehr finden lassen.
Der demografische Wandel der nächsten Jahre wird das Dilemma verschlimmern. Düstere Zeiten für die medizinische Versorgung in Deutschland.
Ein schnelles Gegensteuern wäre dringend erforderlich, um den früher erstrebenswerten Beruf des niedergelassenen Arztes wieder aufzuwerten.
Genau das Gegenteil passiert gerade.
Die Vertreter von Politik und gesetzlichen Krankenversicherungen haben den niedergelassenen Ärzten nun 2-mal schmerzhaft gegen das Schienbein getreten.
Da darf man sich nicht wundern, dass die Ärzte laut über angemessene Konsequenzen diskutieren.
Dr. Martin Mundo
-
Antwort auf Google-Bewertung 1
Sehr geehrter Herr XY,
gerne hätten wir Ihre Kritik persönlich mit Ihnen diskutiert.
Leider ist auch Ihr Name wieder gefälscht, so dass wir nur öffentlich antworten können:
Die Reduzierung des Problems "Wartezeit" auf die Inkompetenz unseres Teams ist schon sehr despektierlich und kann so nicht unkommentiert bleiben.
Am einen Tag ist der Stau bei Dr. Mundo und am nächsten Tag bei Herrn Riedel - da gibt es keinen Unterschied.
Natürlich sind Sie und auch wir unzufrieden über lange Wartezeiten. Das ist doch klar.
Aber das Problem ist äußerst vielschichtig komplex und in nahezu allen Dienstleistungsbereichen vorhanden (z.B. andere Arztpraxen, Notfallambulanzen der Krankenhäuser, Bürgerämter der Stadt, Telefon-Hotlines etc.).
Eine Patentlösung zur Zufriedenheit aller wird es wohl niemals geben.
Ich rate Ihnen zur Lektüre des Artikels "Wartezeit" auf unserer Homepage unter der Rubrik "Aktuelles".
Obwohl wir eigentlich eine Termin-Sprechstunde führen, verlaufen unsere Arbeitstage niemals so, wie sie ursprünglich geplant waren. Das hat viele Gründe: Beispielsweise erscheinen frisch operierte Patienten nach Krankenhaus-Entlassung unangemeldet zur Wundversorgung und Organisation der ambulanten Weiterbehandlung. Die älteren Patienten haben oft nicht nur eine Gesundheitsstörung, sondern wollen gleich etliche Beschwerden behandelt haben, was den geplanten Zeitrahmen sprengt. Nicht selten kommt erst im längeren intensiven Gespräch mit dem Patienten heraus, dass die Rückenverspannungsschmerzen keine orthopädische Behandlung benötigen sondern eine psychische Krisenintervention. Akut Verunfallte und Patienten mit akuten Schmerzzuständen oder neurologischen Ausfallserscheinungen können wir auch nicht wieder wegschicken, damit Sie pünktlich Ihren Termin gewährleistet bekommen können. Ferner bemühen wir uns aus Menschlichkeit und Nächstenliebe, die zahlreichen Patienten, die morgens im Rahmen der Akut-Sprechstunde keinen Platz bekommen haben, in den nächsten Tagen einigermaßen gleichmäßig verteilt dazwischenzuschieben.
Was würde wohl in diesen Bewertungsportalen stehen, wenn wir 1/4 unserer Patienten unbehandelt wegschicken würden, weil unsere Kapazitätsgrenzen überschritten sind?
Auch in unserer Praxis haben bereits medizinische Fachangestellte am Rand ihrer physischen und psychischen Belastungsgrenze frustriert ihren Beruf aufgegeben. Wir haben allergrößte Schwierigkeiten, überhaupt noch Personal zu finden, weil kaum noch jemand als medizinische Fachangestellte arbeiten möchte. Der Krankenstand ist hoch. Oft muss unsere Praxis nur mit einer minimalen Besetzung funktionieren. Da gibt es dann schlicht keine Kraft mehr, die das Telefon bedienen kann. Praxisberater empfehlen, Telefonate zukünftig durch künstliche Intelligenz beantworten zu lassen. Wollen Sie das wirklich so?
Nein!
Wenn alle Beteiligten gemeinsam geduldig rücksichtsvoll und respektvoll miteinander umgehen und nicht nur ihre eigenen Interessen und Vorteile als Mittelpunkt des Universums sehen, dann werden wir auch weiterhin eine großen Anzahl von Patienten hochqualitativ zufriedenstellend behandeln können.
Mit freundlichen Grüßen,
Dr. Martin Mundo
-
Antwort auf Google-Bewertung 2
Sehr geehrte Frau XY,
es ist ziemlich schlicht und auch unfair, mich mit Namen öffentlich anzuprangern, sich selbst aber mit einem Fake-Namen in der schützenden Anonymität zu halten.
Ich entschuldige mich, dass ich nicht erkannt habe, dass Sie an dem Tag die wichtigste Patientin waren. Dann hätte ich selbstverständlich die Patienten vor und nach Ihnen unbehandelt weggeschickt, um mich vollumfänglich Ihren Befindlichkeitsstörungen widmen zu können.
Merken Sie selbst, dass da irgendetwas nicht stimmt, oder?
Nein, ernsthaft: Ich kann mich doch nicht dafür entschuldigen, dass ich viele Patienten gewissenhaft behandelt habe. Ich habe Sie ja nicht warten lassen, um Sie zu verärgern oder weil ich Kaffee-trinkend herumgesessen habe.
Um mich hier nicht zu wiederholen, verweise ich auf den Artikel "Wartezeit" auf unserer Homepage in der Rubrik "Aktuelles".
Wir müssen unter einem gewissen Zeitdruck sehr viele Patienten behandeln, haben dabei mit chronischem Personalmangel zu kämpfen und müssen auch noch eine ordentliche Dokumentation gewährleisten. Unser Terminplaner schafft eine grobe Tagesstruktur. Aus vielerlei Gründen gestaltet sich ein Tag in der Realität oft völlig anders. Gerade ich bin dafür bekannt, mir sehr ausführlich Zeit zur Patientenberatung zu lassen. Ich bin gespannt, wie Sie dies bei etlichen meiner orthopädischen Kollegen erleben werden. Aber auch ich bin gezwungen, ein Patientengespräch strukturiert auf den Punkt zu bringen. In 10min Terminzeit kann man nicht erwarten, alle Beschwerden der letzten Jahre von den Füßen bis zum Kopf zu erörtern. Nebenbei bemerkt wird dies auch absolut gar nicht von der Kassenärztlichen Vereinigung honoriert. Wie Sie sicher schon mitbekommen haben, erhält man eine eher niedrig dotierte Pauschale zur Behandlung eines Problems, nicht für mehrere Probleme. Nach 3 Behandlungen pro Quartal ist der maximale Pauschalbetrag erreicht. Danach erfolgen Behandlungen bis auf wenige Sonderleistungen unentgeltlich. So sind wir auch aus wirtschaftlichen Gründen zu dieser Termintaktung gezwungen. Gerne kann ich mir im Selbstzahlerbereich mehr Zeit für Sie lassen.
Mit freundlichen Grüßen,
Dr. Martin Mundo
-
Antwort auf Google-Bewertung 3
Sehr geehrte/r XY,
Sie haben sich über meinen Kommentar zu Ihrer Ein-Sterne-Bewertung offensichtlich geärgert und beschimpfen mich als „nicht kritikfähig“.
Tatsächlich bin ich für gute konstruktive Kritik mit Verbesserungsvorschlägen zum Wohle aller, der Patienten, des Teams und der Ärzte, sehr offen und dankbar!
Glauben Sie mir, alle Prozesse in der Praxis werden ständig evaluiert, modifiziert und optimiert.
Dabei gibt es aber sorgfältig sehr viele unterschiedliche Aspekte zu beachten, so schränken z.B. viele GKV-Regelungen unseren Handlungsspielraum stark ein.
Nicht umsonst spreche ich oft von „Scheinselbständigkeit“.
Verständlicherweise sehen Sie Ihre eigenen Patienten-Interessen als oberstes Maß aller Dinge.
Haben Sie sich eigentlich mal darüber Gedanken gemacht, welcher Schaden durch diese miesen "Bewertungen" voller Respektlosigkeit, voller Beleidigungen und Herabsetzungen anrichtet wird?
Der Verfasser selbst agiert meistens in schützender Anonymität mit Fake-Namen und bringt häufig falsche und wenig durchdachte Anfeindungen in die Öffentlichkeit.
Ich hingegen werde mit vollständigem echten Namen verleumdet.
Das Internet vergisst nichts. Auch in 50 Jahren wird dieser Unsinn noch über mich nachzulesen sein.
Es braucht schon eine sehr stabile Psyche, um diesen Schmutz ertragen und verkraften zu können – und sich trotzdem jeden Tag aufs Neue voller Freundlichkeit und Engagement für die Patienten-Behandlungen zu motivieren.
Rechtlich habe ich aufgrund von Schweigepflicht und Datenschutz quasi keine Chance, Unwahrheiten gerade zu rücken. Ja, die meisten dieser Ein-Sterne-Bewertungen könnte man wohl löschen lassen, aber das verbraucht Zeit, Geld und Nerven. Die Ressourcen dafür habe ich nicht.
Letztlich schaden die negativen Bewertungen insgesamt dem ärztlichen Ansehen und der gemeinsamen Vertrauensbasis.
Sie begünstigen auch ein gereiztes gesellschaftliches Klima, in dem die Hemmschwelle zu aggressivem Verhalten und Übergriffen deutlich herabgesetzt ist.
Dr. Martin Mundo
-
Wartezeit
Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir stehen für eine menschliche ganzheitliche orthopädische Behandlung auf hohem qualitativem Niveau. Herzlichen Dank für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.
Die Wartezeit ist leider ein häufig geäußertes ärgerliches Problem, das wissen auch wir.
Das ist aber nicht nur bei uns so, sondern Wartezeit ist ein immer wiederkehrendes Thema in zahlreichen medizinischen Foren.
Es handelt sich um eine ziemlich komplexe Problematik.
Eine Patentlösung, die allen Wünschen gleichermaßen gerecht wird, gibt es nicht und gleicht der Quadratur eines Kreises.
Dies möchten wir Ihnen im Sinne eines aufgeklärten vertrauensvollen Arzt-Patienten-Verhältnisses ansatzweise verdeutlichen:
Der Zeitbedarf einer Behandlung lässt sich nur annähernd kalkulieren.
Die Beschwerdeangaben der Patienten bei Terminvergabe und dann später im Sprechzimmer weichen oft erheblich voneinander ab.
Häufig treten Patienten mit mehreren Anliegen an uns heran, was zusätzlich Zeit kostet.
Die Hauptsymptomatik orthopädischer Gesundheitsstörungen sind Schmerzzustände. Diese sind meist vielschichtig und bedürfen auch multimodaler Therapiekonzepte mit individueller Zuwendung. Menschen sind keine Maschinen.
Akute Erkrankungen lassen sich nicht planen. Echte Notfall-Patienten sollen die Gewissheit haben, dass ihnen hier jederzeit gerne unbürokratisch geholfen wird. "Pseudo-Notfälle", wobei man sich mit Drängeln und Dramatisieren eine Sonderbehandlung verschafft, sind für die Solidargemeinschaft belastend und ärgerlich. Leider können wir erst im Sprechzimmer die eine von der anderen Gruppe unterscheiden.
Wir planen 10min pro Patient ein. Erfahrungsgemäß kommt man so gemittelt über die gesamte Sprechstundenzeit ganz gut zurecht.
Weniger Termine zu vereinbaren würde zwar den Sprechstundenablauf entzerren und Stress reduzieren, bedeutet jedoch auf der anderen Seite, dass Sie auf ihren Termin wesentlich länger warten müssten.
Etwa 5-10 Patienten pro Tag lassen ohne abzusagen den für sie reservierten Termin ungenutzt verfallen.
Eine Arztpraxis ist nicht zuletzt ein zur Wirtschaftlichkeit gezwungener Betrieb. Wie alle anderen haben wir Ausgaben in Form von Steuern, Gehältern, Miete mit Nebenkosten, Versicherungen etc. zu zahlen. Entsprechend müssen wir auch Einnahmen durch eine angemessene Anzahl von Patientenbehandlungen generieren. Die gesetzlichen Krankenversicherungen honorieren eine längere Behandlungszeit gar nicht. Egal ob ein Anliegen oder mehrere behandelt wurden, es kann nur eine relativ geringe Pauschale abgerechnet werden. Nach dem 3. Kontakt im Quartal arbeiten wir mit Ausnahme weniger Sonderleistungen unentgeltlich. Bei privaten Krankenversicherungen wird jede Behandlung bezahlt und bei >10min Behandlungsdauer kann der Steigerungsfaktor erhöht werden.
Eine hohe Patientenzahl am Ende eines Quartals ist entscheidend für die Zuteilung von Geldern (Budget) und ist somit wichtig für die Stärke der Praxis. Andernfalls könnten wir ihnen viele Leistungen nicht mehr im gewohnten Maß verordnen.
Wir hoffen, mit diesen Ausführungen ein Bewusstsein für die Komplexität des Problems Wartezeit schaffen zu können.
Wir wollen Sie ganz sicher nicht verärgern und sitzen nicht Kaffee-trinkend herum.
Bitte lassen Sie ihre Ungeduld nicht an unseren Arzthelferinnen aus.
Mit gegenseitiger Rücksichtnahme, Verständnis, Toleranz und Respekt von Seiten aller Beteiligten werden wir die Situation zur Zufriedenheit aller meistern können.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Mundo / Riedel
-
Verordnungen
Häufig werden unsere medizinischen Fachangestellten gedrängt, "mal eben zwischendurch" ein Rezept, eine Heilmittelverordnung, eine Bescheinigung etc. auszustellen.
Der Gesetzgeber hat mit Absicht und allen rechtlichen Konsequenzen diese Tätigkeit in die Verantwortung des Arztes gelegt. Folgeverordnungen sind kein Automatismus, sondern müssen sich an dem jeweiligen Befund orientieren. Entsprechend erfolgt diese Tätigkeit im Rahmen der Sprechstunde. Die Anfragen zwischendurch stören unnötig den Ablauf der Sprechstunde und sollten unterlassen werden.
Bitte vereinbaren Sie einen Termin!
-
Hygieneregeln
Die Corona-Pandemie hat uns einmal mehr gelehrt, wie wichtig vorsichtiges und rücksichtsvolles Verhalten jedes Mitglieds unserer Gesellschaft ist.
Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass Sie bitte auch weiterhin alle notwendigen Hygienemaßnahmen einhalten.
Bei Hinweisen auf eine ansteckende Erkrankung meiden Sie bitte unbedingt Menschenansammlungen wie unsere Praxis, und wenden Sie sich telefonisch an Ihren Hausarzt.
Im Zweifelsfall oder bei Immunschwäche tragen Sie bitte freiwillig eine FFP2-Maske.
Tun Sie dies zum Schutz aller, für sich, für die anderen Patienten und für unser Team.
Vielen Dank !
-
Arthrose
Die weltweit häufigste Gelenkerkrankung betrifft vorrangig Knie, Hüfte, Fuß sowie die unteren Wirbelgelenke, da diese im Leben großen Belastungen ausgesetzt sind. Grundsätzlich können aber alle Gelenke des Körpers betroffen sein.
Hervorgerufen wird das Leiden durch Verschleiß von Knorpelmasse, die sich als Schutzschicht an beiden Knochenenden im Gelenk befinden. Im Normalfall verhindert diese, dass Knochen aufeinander reiben und dient zudem als Stoßdämpfer bei Bewegungen.
Ist die Schutzschicht abgenutzt, verursacht dies Reibeschmerzen und führt zu Gelenkeinsteifung.
Arthrose gilt als degenerative Erkrankung. Man kann sie letztlich nicht heilen, nicht rückgängig machen.
Es lässt sich aber mit ihr leben!
Aktivierte Reizzustände können sich durch diverse konservative Maßnahmen wieder bessern und zur Ruhe kommen.
Gereizte Arthrose-Gelenke wollen gekühlt und mit einem elastischen Wickelverband stabilisiert werden. Im beruhigten Zustand sind Wärmungen angenehm und durchblutungsfördernd.
Bei moderaten Beschwerden sollten Sie die betroffenen Gelenke nicht schonen, sondern weiterhin regelmäßig im Rahmen Ihrer Möglichkeiten benutzen. Nur so wird Knorpelmasse hinreichend durchblutet und mit Nährstoffen versorgt, was dem Abbau entgegenwirkt.
Empfohlen werden wenig Gelenk-beanspruchende Sportarten wie Schwimmen, Aquagymnastik, Radfahren und Nordic Walking. Vermieden werden sollten High-Impact-Sportarten mit abrupten Richtungswechseln, Sprinten, Abstoppen, Springen, Gegnerkontakt wie z.B. bei Fußball, Handball, Volleyball, Basketball, Tennis, Badminton etc.
Auch durch Ernährung kann man den Krankheitsverlauf beeinflussen.
Dabei steht die Normalisierung des Körpergewichtes an aller erster Stelle! Durch hohe Druckbelastungen werden Arthrose-Schäden verschlechtert. Niedrige Druckbelastungen schonen die Knorpelschicht.
Eine aktivierte Arthrose entspricht letztlich einem mechanisch ausgelösten Entzündungsprozess.
Entzündungshemmend kann der Verzehr von bestimmten Gemüsesorten und das Kochen mit Pflanzenölen sein. Ferner werden verschiedene Gewürze empfohlen wie z.B. Chili, Zimt und Kurkuma. Als „natürliches Schmerzmittel“ wird oft ein Mix aus Kreuzkümmel, Koriander und Muskat angepriesen, mit dem sich Speisen verfeinern lassen. Zusätzlich können Ingwer und Grünlippmuschel lindern, die man als Pulver oder in Kapseln kaufen kann.
Wir helfen Ihnen oft durch das Einspritzen von Hyaluronsäure unter sterilen Bedingungen in das geschädigte Gelenk. Dies verbessert die Viskoelastizität der Gelenkflüssigkeit. Schmierende und stoßdämpfende Eigenschaften werden wiederhergestellt, was zu einer verbesserten Beweglichkeit und Schmerzlinderung führt. Sprechen sie uns darauf an!
Oft helfen schon einfache Mittel, um akute Schmerzzustände zu lindern.
Akut schmerzhaft geschwollene Extremitätengelenke sollten Sie schonen, hoch lagern, wiederholt kühlen, elastisch stabilisierend verbinden.
Akut schmerzhaft verspannte, verkrampfte Muskulatur z.B. am Rücken sollten Sie schonen, wiederholt wärmen, vorsichtig dehnen.
Keine Kälte- oder Wärmepackungen direkt auf die nackte Haut, stets eine Stoffschicht dazwischen!
Zu den Zivilisationskrankheiten unserer Zeit gehören unter anderem Bewegungsmangel bzw. monotone Belastungen und Übergewicht.
Regelmäßige moderate Bewegungen und ausgewogene Ernährung sind wesentliche Säulen unserer Gesundheit.
Die verknüpften Internet-Seiten können Ihnen dabei Hilfestellungen bieten:
Fitness-Übungen: https://www.gesundheit.de/fitness-id213561/
Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen: https://www.youtube.com/watch?v=Qz-3YHaeGb4
(Für die Inhalte der verknüpften Seiten können wir keine Verantwortung übernehmen)
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag
08:00 - 13:00 | 14:00 - 17:00 Uhr
Mittwoch
08:00 - 13:00 Uhr
Freitag
08:00 - 14:00 Uhr
Letzter Einlass 30min vor Sprechstunden-Ende
Telefon-Sprechzeiten:
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag
11:00 - 12:30 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag
14:30 - 15:30 Uhr
Zur Akut-Sprechstunde mit Wartezeit bitte um kurz vor 08:00 Uhr vor der Praxis sein.
Da oft großer Andrang herrscht und nur begrenzt Zeit zur Verfügung steht, wird eine Dringlichkeitsliste geführt.
Wenn Röntgen-Aufnahmen erforderlich sind, bitte 30min vor Ihrem Termin in der Praxis melden.
Fax: